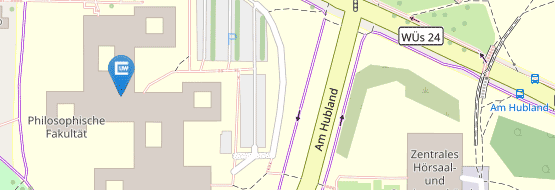Qualifikationsverfahren
Laufende Qualifikationsverfahren
Betreuung:
Prof. Dr. Christoph Vatter (Jena), Prof. Dr. Brigitte Burrichter (Würzburg)
Die wissenschaftliche Studie widmet sich dem Phänomen Racial Profiling. Darunter versteht man im Polizeikontext eine Praxis, bei der Menschen meist im Rahmen verdachtsunabhängiger Kontrollen ausschließlich aufgrund ihrer äußerlichen Merkmale wie zugeschriebene Hautfarbe, Ethnie oder Religionszugehörigkeit kontrolliert werden.
Am Beispiel der Bayerischen Polizei in Unterfranken soll untersucht werden,
- in welcher Form Racial Profiling im Polizeialltag in Erscheinung tritt,
- welche Kulturstandards von Polizist:innen gesetzt werden,
- wie sich die Behördenleitung zu dem Thema positioniert
- und was in der Organisation gegen Racial Profiling und andere Diskriminierungsformen unternommen wird.
Dabei soll u. a. die Wirkung des eintägigen Präventionsworkshops zum Thema Menschenrechte, Extremismus, Vielfalt und Verantwortung für Zwischenvorgesetzte untersucht werden, der von der Arbeitsgruppe Prävention in der Organisation gegen Extremismus (AG PRIOX) des Polizeipräsidiums Unterfranken entwickelt und im Zeitraum von Juli 2021 bis April 2023 mit der Zielgruppe der Zwischenvorgesetzten durchgeführt wurde.
Als Untersuchungskorpus dienen die Werte, Normen und Leitlinien der Organisation, Beobachtungsprotokolle und Feldnotizen, Einzelinterviews mit der Behördenleitung, Führungskräften und Zwischenvorgesetzten sowie Gruppendiskussionen mit Polizist*innen des mittleren Dienstes.
Mit empirischen und kulturwissenschaftlichen Methoden soll in einem ersten Schritt der Ist-Zustand der institutionellen Haltung zu Racial Profiling analysiert werden, während die Entwicklung von mögliche Lösungsansätzen im zweiten Schritt im Fokus stehen, um Kulturstandards aufzubrechen und das Konzept einer inklusiven, diskriminierungssensiblen Polizei zu entwerfen.
Betreuung:
Prof. Dr. Martha Kleinhans (Würzburg), Prof. Dr. Brigitte Burrichter (Würzburg), Prof. Dr. Stephanie Neu-Wendel (Mannheim)
Das Dissertationsvorhaben beschäftigt sich mit der Frage, wie bewusster Sprachwechsel und die dadurch gewonnene Distanz zur Muttersprache sich auf das literarische Schaffen von AutorInnen auswirken. Nicht nur die sprachliche Distanz, sondern auch die geographische Distanz zum Geburtsland durch Migration beeinflussen Themen, Perspektiven und narrative Strategien. Um die Bedeutsamkeit der ausgewählten Texte für die Literatur- und Kulturwissenschaften herauszuarbeiten, soll ein besonderes Augenmerk auf narrativen und stilistischen Strategien liegen, die von Migrationsphänomenen mitbedingt sind. Auch eine mögliche Traumabewältigung dank literarischen Schreibens wird eine zentrale Rolle spielen.
Für die Literatur- und Kulturwissenschaften ist die Untersuchung von Sprachwechsel insofern bedeutsam, als dieser – auch durch die Verbindung zu Migration – mit einem Zugewinn an kulturellen Einflüssen auf Identität und Literatur einhergeht sowie Fragen zur kulturellen Zugehörigkeit aufwirft. Identität und Zugehörigkeit sind im Zuge der Beschäftigung mit transkultureller, postkolonialer und Migrationsliteratur zentrale Kategorien. Das Thema Sprachwechsel wird weiterhin für Literatur- und Kulturwissenschaft fruchtbar gemacht, indem die damit zusammenhängenden Phänomene und narrativen Strategien als mögliche Mittel zur Auseinandersetzung mit und Bewältigung von Traumata in der Literatur betrachtet wird.
Zur Beleuchtung der genannten Themenkomplexe sollen Werke der aus Albanien stammenden Autorinnen Ornela Vorpsi, die ihre ersten Romane auf Italienisch veröffentlichte, nun aber seit 2014 auf Französisch publiziert, und Bessa Myftiu, die in französischer Sprache schreibt, dienen. Ornela Vorpsi wurde 1968 in Tirana geboren, lebte von 1991 bis 1997 in Mailand und zog anschließend nach Paris, wo sie ihre schriftstellerische Karriere begann und bis heute lebt. Bessa Myftiu, geboren 1961, migrierte 1991 in die Schweiz, lebt seit 1992 in Genf und geht dort ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin nach.
Die Konzentration auf Albanien hängt konkret mit dem gemeinsamen Herkunftsland der gewählten Autorinnen zusammen, wobei durch den doppelten Sprach- und Ortswechsel Ornela Vorpsi eine Sonderstellung zukommt. Traumatische Erlebnisse in Kindheit und Jugend sowie Migrationserfahrungen prägen die Werke beider Autorinnen. Traumata wie diese, die von diktatorischen oder kolonialen Regimes hervorgerufen werden können, werden von SchriftstellerInnen literarisch verarbeitet. Albanien wurde für das Dissertationsprojekt gewählt, da das Land im Zuge der Besatzung durch Italien im Jahr 1939 und der sozialistischen Hoxha-Diktatur von 1944-1990 solchen Herrschaftsformen ausgesetzt war. Wie viele andere AlbanerInnen verließen sowohl Ornela Vorpsi als auch Bessa Myftiu Albanien kurz nach Ende der Diktatur.
Obwohl es zu Vorpsis Veröffentlichungen schon punktuelle Forschungsliteratur gibt, wurde bisher weder ihr Gesamtwerk in einer Monographie behandelt, noch der Akzent auf die konkreten Auswirkungen des doppelten Sprachwechsels gelegt. Bessa Myftiu kam hingegen in der Forschungsliteratur noch nicht die ihr angemessene Aufmerksamkeit zu.
Mithilfe narratologischer und semiotischer Methoden und Ansätze werden konkrete Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgezeigt und analysiert. Für die Untersuchung können auch weitere aus südosteuropäischen Ländern stammende AutorInnen mit einbezogen werden. Im Vergleich mit Werken männlicher Autoren wird sich zeigen, ob auch Genderaspekte für die Dissertation relevant sind.
Betreuung:
Prof. Dr. Gerhard Penzkofer (Würzburg), Prof. Dr. Brigitte Burrichter (Würzburg), PD Dr. Irmgard Scharold (Münster)
Das lyrische und das dramatische Werk des spanischen Dichters Federico García Lorca (1898-1936) wurden umfassend und vielfach analysiert und kommentiert. Eine andere Situation liegt hinsichtlich seiner poetologischen Vorträge vor: Diese waren nur punktuell Gegenstand einer intensiven Kommentierung und sind zumeist in Analysen der poetischen, literarischen oder narrativen Texte Lorcas integriert. Das Dissertationsprojekt wählt einen anderen Ansatz: Es rückt die Vorträge in den Vordergrund und legt eine umfassende Analyse von Lorcas frühen poetologischen Vorträgen vor.
Speziell werden die ersten vier Vorträge Lorcas untersucht:
Importancia histórica y artística del primitivo canto andaluz llamado "cante jondo" (1922), La imagen poética en don Luis de Góngora (1926-1930), Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos (1926) und Imaginación, inspiración, evasión (1928).
Das Projekt erarbeitet eine umfassende Darstellung der Inhalte, Thesen, Verfahren sowie literatur- und diskursgeschichtlichen Verflechtungen dieser Texte. Der methodische Fokus bei der Darstellung setzt an einem Spezifikum Lorcas und der generación del 27 an: Traditionelle Gegenstände treten in Lorcas Texten gemeinsam mit avantgardistischen Zielsetzungen und Verfahren auf. So haben seine Vorträge den Flamenco bzw. cante jondo oder die Barockdichter Luis de Góngora und Soto de Rojas zum Gegenstand oder reflektieren Lorcas eigene Verwendung der traditionellen Romanzenform. Bei der Perspektivierung dieser Kopräsenz von Avantgardismus und Traditionalität greift die Arbeit auf zwei Ansätze zurück. Zum einen ist dies der Ansatz von Schneider (2005), der wiederum auf den Ansatz von Gumbrecht (1982) zurückgreift. Die Genannten verstehen Lorcas Interesse an den genannten Gegenständen gerade als Ausdruck seines Avantgardismus, da diese bis dato aus dem literarischen und künstlerischen Kanon ausgeschlossen waren. Als Gründe sehen sie deren Inkommensurabilität mit den poetologischen Fundamenten der hegemonialen Literaturkritik und -geschichtsschreibung. Mit den Poetiken der Avantgarden seien die Themen aber vor allem aufgrund des knappen und kondensierenden Ausdrucks kompatibel, der seine Hauptmanifestation in der Metapher findet. Zum zweiten greift die Arbeit auf García Monteros Formel einer 'avantgardistischen Lektüre der Tradition' (García Montero 1990, 2007) zurück: Lorca filtert, so García Montero, traditionelle Gegenstände durch die 'metaphorischen Prozesse der Avantgarden'. Im Anschluss daran setzt die Arbeit die spezifisch moderne schöpferische Imagination ins Zentrum dieser Prozesse, die bei Lorca zu beobachten ist und in Nachfolge des Creacionismo und dessen Rezeption des französischen Symbolismus sowie unter Einfluss von Ortega y Gassets Begriff der deshumanización steht. Durch Lorcas Anwendung dieses Imaginationskonzepts auf die genannten Gegenstände kommt, wie die Arbeit argumentiert, eine avantgardistische Perspektivierung und teils Vereinnahmung der traditionellen Gegenstände zustande. Gegenüber der genannten Ansätze ist ein Spezifikum des Dissertationsprojektes, dass diese Ansätze nicht primär auf Lorcas lyrische Produktion oder auf einzelne Aussagen seiner Vorträge, sondern dezidiert und in einer umfassenden Analyse und Kontextualisierung auf einen chronologisch zusammenhängenden Ausschnitt auf Lorcas Vortragswerk angewandt werden. So wird die jeweilige Adäquatheit der genannten Ansätze erprobt und auf ein größeres Korpus bezogen. Dabei werden Kontinuitäten wie Diskontinuitäten in Lorcas poetologischer Entwicklung herausgearbeitet. So wird etwa herausgestellt, dass Lorcas Vorträge über den cante jondo und über Luis de Góngora bei zahlreichen Unterschied nicht zwei vollkommen disparaten Phasen zuzuordnen sind, wie oftmals angenommen, sondern über das Merkmal der avantgardistischen Lektüre und dem Interesse am knappen, essentiellen metaphorischen Ausdruck der schöpferischen Metapher auch miteinander verbunden sind.
Mit ihrem Korpus schlägt die Arbeit den Bogen von Lorcas früher "folkloristischer" Phase über seine "gongorinische" oder "enthumanisierte" Phase bis zu seiner surrealistisch geprägten Phase.
verteidigt
Betreuung:
Prof. Dr. Esme Winter-Froemel (Würzburg), Prof. Dr. Waltraud Weidenbusch (Heidelberg, Regensburg), Prof. Dr. Bariş Kabak (Würzburg)
Die Dissertation beschäftigt sich mit der Rolle der Prosodie bei der Disambiguierung syntaktisch ambiger Sätze. Syntaktisch ambige Sätze haben bei gleicher Abfolge der Konstituenten eine unterschiedliche hierarchische Struktur. Diese spiegelt sich in der Prosodie in Form von unterschiedlichen Phrasierungen wider. Ziel der Dissertation ist die Analyse von Position und akustischen Eigenschaften (Grenztöne, phrasenfinale Längung, Sprechpausen, Akzentuierung) von Phrasengrenzen in rund 1800 syntaktisch ambigen Sätzen. Dabei steht insbesondere der Sprachvergleich zwischen dem Französischen und Spanischen im Vordergrund sowie der Vergleich von verschiedenen Arten von syntaktischer Ambiguität und von unterschiedlichen Bedingungen bezüglich Bewusstheit der Sprecher über die Ambiguität und Vorhandensein von Kontext.
Betreuung:
Prof. Dr. Brigitte Burrichter (Würzburg), Prof. Dr. Thomas Baier (Würzburg), Dr. Anne-Laure Metzger-Rambach (Bordeaux Montaigne)
Die angestrebte Arbeit hat zum Ziel, die Rolle des Paratexts in der europäischen Rezeption und Tradierung des Narrenschiffs um 1500 zu ermitteln. Hierzu wird eine Untersuchung der Formen und Funktionen des Paratexts in drei seiner Übersetzungen durchgeführt.
Paratexte umgeben den eigentlichen Text; sie leiten ihn ein und kommentieren ihn, unterbrechen manchmal auch den Textfluss mit Kommentaren, Verweisen oder Illustrationen. Durch die Paratexte wird das veröffentlichte Werk zu einem Text mit mehreren Verfassern, dessen Pluralität die Pluralität, die jeder Übersetzung eigen ist, erweitert. Die Vielfalt der Stimmen, die den Text umgeben (Herausgeber, Mäzene, anonyme Gelehrte), und die Pluralität der "eingenommenen" Räume zeigen, dass die Paratexte der Ort einer vielfachen Rezeption des Textes sind.
Die belehrende Literatur hat in der Frühen Neuzeit großes Gewicht, dem eindeutige Forschungslücken gegenüberstehen. In dieser Arbeit soll der hohe Stellenwert der moralischen Literatur in dieser Epoche – die ein Weg der Strukturierung und Vermittlung von Wissen zwischen Gelehrten und Nicht-Gelehrten bildet – erforscht werden. Die Wahl von Übersetzungen gibt dem Korpus eine Kohärenz, die in der zeitgenössischen Rezeption dieser Texte selbst begründet ist: Die Textübersetzung bildet eine Wertschätzung des Ausgangstextes, der für würdig befunden wird, in einer anderen Sprache verbreitet zu werden. Während eine lateinische Übersetzung die Absicht auf eine möglichst weitgehende Verbreitung des Textes zeigt, entspringt die Übersetzung in die Volkssprache dem Wunsch, das Zielpublikum des Textes um die illiterati (die kein Latein lesen können) zu erweitern.
Das Korpus dieser Arbeit umfasst fünf Drucke, die zwischen 1497 und 1499 erschienen sind und in Latein und Französisch verfasst wurden. Es handelt sich um zwei lateinische und drei französische Übersetzungen des Narrenschiffs von Sebastian Brant, einer Moralsatire in alemannischer Sprache aus dem Jahre 1494. Die Bedeutung und Besonderheit dieser Werke liegt in ihrer unmittelbaren Rezeption auf europäischer Ebene, die sie zu Schlüsseltexten der belehrenden Literatur ihrer Zeit macht und das Narrenschiff zum "ersten Bestseller" der Frühmoderne gemacht hat.
Betreuung:
Prof. Dr. Esme Winter-Froemel (Würzburg), Prof. Dr. Waltraud Weidenbusch (Heidelberg, Regensburg), Prof. Dr. Wolf Peter Klein (Würzburg)
Der beständige Wandel im Wortschatz einer Sprache kann auf eine Vielzahl unterschiedlicher Ursachen zurückgeführt werden. Es liegen jedoch bislang kaum Untersuchungen vor, die Humor als relevanten Faktor und eigenständiges Motiv für Wortschatzerweiterung in den Blick nehmen. Unter Einbezug von Erkenntnissen sowohl der Sprachwandelforschung als auch der Humorforschung umfasst das Dissertationsprojekt unterschiedliche methodologische Ansätze, um auf verschiedenen Wegen Antworten zu finden auf die Frage: Wodurch zeichnet sich humoristische Wortschatzinnovation im modernen Spanisch hinsichtlich semantischer Aspekte, Entstehung, Gebrauch und Rezeption aus?
Der erste Teil der Arbeit beinhaltet lexikographische und metalexikographische Analysen sowie verschiedene Ansätze zur Kategorisierung der untersuchten Einheiten, um relevante Eigenschaften und Merkmale offenzulegen, die (potenziell) humoristische Wortschatzeinheiten des Spanischen kennzeichnen bzw. diesen zugeschrieben werden. Hierzu gehören beispielsweise formale Aspekte sowie die Etymologie der Einheiten (z.B. Wortbildungstyp, Gebersprache etc.), aber auch semantische Aspekte (z.B. Quell- und Zielkonzept, Tabuthemen etc.) sowie Angaben zur diasystematischen Markiertheit.
Im zweiten Teil der Arbeit stehen qualitative Korpusanalysen im Mittelpunkt, mithilfe derer wiederkehrende Merkmale im Kotext der untersuchten Einheiten ermittelt werden. Die gewonnenen Ergebnisse werden mit der vorliegenden Forschungsliteratur zur Markierung von verbalem Humor, Ironie und Sarkasmus verglichen, um mögliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen zu können.
Der dritte Teil der Arbeit ist der Perzeption und Rezeption humoristisch geprägter Wortschatzinnovationen gewidmet, die anhand einer Fragebogenstudie erforscht werden sollen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt hier auf der vergleichenden Betrachtung verschiedener Altersgruppen, wobei die Frage im Mittelpunkt steht, wie die Wortschatzeinheiten in bestimmten Ko- bzw. Kontexten von Sprecher*innen des Spanischen wahrgenommen bzw. verstanden werden, und welche Unterschiede sich diesbezüglich in verschiedenen Altersgruppen erkennen lassen.
Betreuung:
Prof. Dr. Horst Weich (München), PD Dr. Jörg von Brincken (München), Prof. Dr. Gerhard Penzkofer (Würzburg)
Perfekt arrangierte Bildtableaus, ausgestellte gestaltete Körper, Selbstbezüglichkeit im intermedialen Geflecht, Bilder aus fremden und eigenen Zitaten sind wohl die Schlagworte, wenn man auf ästhetischer Ebene an die Filme von Pedro Almodóvar denkt. Diese Arbeit des Œuvres Almodóvars will die Perspektive eröffnen auf die Inszeniertheit von Figuren, Beziehungen, Räumen, auch dann, wenn die Filme eine ernstere, melancholischere Richtung einschlagen, und das Theatrale herausarbeiten und als interpretatorische Linie zugänglich und anschlussfähig machen. Dabei wird auch immer wieder das Selbstreflexive sichtbar, das nicht nur als filmische Eigenart oder Stilmerkmal Almodóvars zu sehen ist, denn gerade diese Rückgriffe auf das Spielerische der movida madrileña verweisen so permanent auf die Konstruiertheit der Geschichten, die Artifizialität der Figuren, die Inszenierung der Beziehungen. Es liegt die Frage zugrunde, wie die gesellschaftliche Situation, wie die geschlechtliche Verfasstheit der Figuren, wie die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Perspektive eines (Über-)Spielens vermittelt werden. Die Untersuchung einer permanent vorhandenen Theatralität hebt Almodóvars Filme damit aus einer Betrachtung als ideologisch konstituierende Thesenfilme heraus.Der manieriert wirkende Begriff des Theater/Films hilft, beide Medien samt ihrer jeweiligen Spezifika weiterhin greifbar und analysierbar zu behalten, beide Medien aber auch in einem ästhetisch-methodischen Verbund zu begreifen und auf die Filme zu legen. Ausgehend von einer Werkschau sollen ästhetische Linien und Strukturen des theatralen Spielens, die anfangs in exaltierender Überfülle vorhanden waren, herausgearbeitet werden und in den späteren Filmen als Dimension wieder sichtbar gemacht werden, um so den späteren Filmen und ihren schwereren Themen eine kontinuierlich inszenierte Interpretationsmöglichkeit einzuschreiben.Die Aspekte, die dabei einer intensiveren Betrachtung unterzogen werden: Figurenkörper, Beziehungsgeflechte und Räume mit Zuschauern.
Betreuung:
Prof. Dr. Gerhard Penzkofer (Würzburg), PD Dr. Irmgard Scharold (Münster), Prof. Dr. Brigitte Burrichter (Würzburg)
Diese Dissertation beschäftigt sich mit der Kolonialliteratur Lateinamerikas, also mit den Chroniken und Schriften des 16. und 17. Jahrhunderts, der sogenannten historiografía indiana. Mein Textkorpus betrifft die Eroberung Perus. Es setzt sich wie folgt zusammen:
- Pedro de Cieza de León: La crónica del Perú (1540-1550) - Agustín de Zárate: Historia del Descubrimiento y Conquista del Perú (1555) - Diego Fernández, el Palentino: Historia del Perú (1571) - Pedro Pizarro: Relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú (1571) - Garcilaso de la Vega: Comentarios reales de los Incas (1609) - Guaman Poma de Ayala: El primer nueva corónica y buen gobierno. (1615/1616) - Martín de Murúa: Historia del Pirú (1616)
Die Eroberung Perus unterscheidet sich von anderen Eroberungen insbesondere durch die brutalen und langandauernden Bürgerkriege. Bereits vor der Eroberung Perus fanden kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den Angehörigen verschiedener Linien des Inkageschlechts statt, nämlich jener Inka Huáscars und seinem unehelichen Halbruder Inka Atahualpa. Jedoch erlangte der bereits vorherrschende Bruderkrieg durch die Eroberung eine neue Dimension: Es kam zu intensiven kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den erobernden Spaniern, in erster Linie repräsentiert durch die Familie der Pizarros auf der einen, sowie die Anhänger Diego Almagros auf der anderen den Seite. Beide Erobererparteien kämpften also nicht nur gegen die Indigenen, sondern sie bekämpften sich gegenseitig und lösten damit einen Jahrzehnte lang andauernden Bürgerkrieg in Peru aus.
Dieser bislang aus literaturwissenschaftlicher Sicht kaum erforschte Bürgerkrieg ist Gegenstand meiner Arbeit. Im Zentrum steht die Untersuchung der narratologischen Perspektivierung dieser Gewaltakte in den Chroniken des 16. bzw. 17. Jahrhunderts, darüber hinaus auch die damit verbundene Rhetorik der Sympathielenkung für eine der Parteien und die Analyse der Darstellung des Eigenen und des Fremden im Gewaltkontext. Bezugsliteratur hierfür ist Tzvetan Todorovs Die Eroberung Amerikas: Das Problem des Anderen (1985).
Wesentlich ist diese Untersuchung deshalb, weil ethnische Verbindungen in Peru im Kontext von Gewalt und Terror – unüblich für Bürgerkriege – weniger relevant sind, um die eigene Identität zu definieren sowie sich vom Anderen zu differenzieren; viel relevanter ist der Aspekt der vorteilshaften Koalitionsbildung und trotz allem die moralische Überlegenheit gegenüber dem als „anders“ Empfundenen, die im Zweifel durch die Verleugnung und Nicht-Anerkennung der eigenen Gewalt in den Texten manifestiert wird.
Die Arbeit wird wie folgt aufgebaut: In einem ersten Schritt soll definiert werden, was Bürgerkrieg zu jener Zeit bedeutet, daraufhin wird die Lesart der Chroniken als nicht rein faktuale sondern auch fiktionale Texte erläutert und meine Untersuchungsmethodik geklärt. Im Hauptteil meiner Arbeit wird das Korpus an Chroniken und Schriften untersucht, wobei neben der Darstellung der Gewalt auch den Aspekten der Verknüpfung von Gewalt und Religion sowie Gewalt und Ökonomie Rechnung getragen werden soll.
verteidigt
Betreuung:
Prof. Dr. Martha Kleinhans (Würzburg), Prof. Dr. Brigitte Burrichter (Würzburg), Prof. Dr. Rita Librandi (Neapel)
Dieses Dissertationsprojekt möchte anhand einer differenzierten sprachlich-stilistischen und kulturwissenschaftlichen Analyse der Alltagsbilder in den Briefen Caterinas da Siena einen Beitrag zur Erforschung der volkssprachlichen Briefe Caterinas leisten und unter Einbezug aktueller Bildtheorien nicht nur der mediävistischen Mystikforschung, sondern auch den rhetorischen Bildwissenschaften innovative Impulse geben.
Caterina Benincasa (1347-1380), Tochter des Färbers Iacopo Benincasa aus Siena, Mystikerin, heiliggesprochen (1461), zur Kirchenlehrerin erhoben (1970), ist eine der berühmtesten Frauen der abendländischen Geschichte. Erst in den letzten Jahren wurde sie als die erste italienische Autorin entdeckt: in einer Zeit, in der Frauen meistens des Schreibens nicht mächtig waren, hinterlässt sie über 380 Briefe an Verwandte, Politiker, Herrscher, adlige Damen und Frauen der Bourgeoisie, Kardinäle und sogar Päpste sowie "Il dialogo della divina provvidenza ovvero il Libro della divina dottrina" und die "Orazioni". Das Korpus, Objekt dieser Studie, die 383 Briefe Caterinas, öffnet ein weites Forschungsfeld durch seine große Vielfalt und Realitätsanbindung aufgrund der zahlreichen, unterschiedlichen Adressaten und der darin betrachteten Themen: Politik, Kirche, Moral, Auslegung der Schrift, …; diese zeigen Caterinas Einfluss auf das Leben von Zeitgenossen, Staat, Stadt und Kirche (Familienmitgliedern, Freunden, Politikern, Priestern, ...) und erlauben sowohl einen linguistischen und literarischen als auch einen kulturwissenschaftlichen Forschungsansatz. Als das unbestreitbar größte und bedeutendste Beispiel des "Subgenus Mystiker-Brief" ist das Korpus der 380 Briefe ein hochinteressantes Forschungsobjekt für eine systematische, sprachlich-stilistische Textanalyse. Die faszinierende und selbstbewusste Bildsprache und die zielorientierte Rhetorik Caterinas wurden bisher leider nur punktuell erforscht. Diese Dissertation möchte anhand einer präzisen Textanalyse die Frage nach dem individuellen Stil Caterinas beantworten und ihre Scrittura in den Kontext des literarischen toskanischen Trecento einordnen.
Arbeitsschritte dieses Projektes:
- Intensive Auseinandersetzung mit der Primär- und Sekundärliteratur Caterinas und Zusammenführung der verschiedenen Forschungstraditionen (Italien, Deutschland, Frankreich, US-amerikanischer Raum)
- Präzise philologische Analyse ausgewählter Alltagsbilder und die systematische Aufgliederung genauer Bildfelder durch die Erstellung eines Glossars
- Lexikalische Analyse und Reflexion über die angewandte Sprache (Caterina ist die erste bedeutende Schriftstellerin im Volgare.)
- Untersuchung der Funktion(en) von Caterinas visuellem Sprechen innerhalb des Subgenus 'Mystiker-Brief'
- Kulturwissenschaftliche Einbettung von Caterinas Bildsprache (Einfluss der christlichen Literatur, ihrer Weiblichkeit und ihres Lebensumfeldes auf die Texte)
Vorgesehen ist die Aufarbeitung der Forschungsergebnisse in Vorbereitung eines möglichen Kooperationsprojektes des Centro Internazionale di Studi Cateriniani (CSC) mit dem Würzburger Kallimachos-Zentrum für Digital Humanities zur Unterstützung weiterführender Studien, z. B. für Arbeiten für die Kritische Ausgabe der Briefe Caterinas.
verteidigt
Betreuung: Prof. Dr. Christian Wehr (Würzburg)
Betreuung:
Prof. Dr. Regina Toepfer (Würzburg), Prof. Dr. Joachim Hamm (Würzburg), Prof. Dr. Brigitte Burrichter (Würzburg)
"fictio – oder was ist das Literarische an der Literatur?"
Die Frage nach einer Existenz fiktionaler Sinngebungsverfahren in vormoderner Erzählliteratur wird in der mediävistischen Forschung bereits seit mehreren Jahrzehnten aus unterschiedlichen Blickwinkeln kontrovers diskutiert, doch konnte sie – vor allem aufgrund der Heterogenität der Ursprungsmaterie – bisher noch nicht gänzlich zufriedenstellend beantwortet werden. Dieses Dissertationsprojekts mit dem vorläufigen Arbeitstitel "Abenteuer des Erzählens – Möglichkeiten fiktionaler Sinnkonstitution im Höfischen Roman" beschäftigt sich deshalb mit einer kritischen Neuvermessung jener Thematik, die für das Verständnis mittelalterlichen Schrifttums als elementar angesehen wird.
Anstelle einer weiteren theoretischen Konzeptualisierung, wie sie zuletzt den Forschungsdiskurs dominierte, sollen den Ausgangs- und Mittelpunkt der Analysen jedoch die Primärtexte bilden. Gerade durch den Einbezug auch bisher randseitiger Werke erhofft sich die Untersuchung damit – unter Berücksichtigung der spezifischen, differenten Bedingungen vormodernen Erzählens sowie des Entstehungsprozesses der Romanliteratur – eine Erweiterung der Perspektive auf mögliche Ebenen und mannigfaltige Verfahren mit dem Potential, jeweils textindividuell einen fiktionalen Rezeptionsmodus zu stimulieren. Dabei soll außerdem gezeigt werden, wie insbesondere die Anbindung an neuere narratologische Konzepte wie "Narrativität" bzw. "Erfahrungshaftigkeit" für die historische Fiktionalitätsforschung fruchtbar gemacht werden kann.
Der Fokus der Arbeit liegt dabei auf dem Höfischen Roman, doch zur Auslotung gerade auch der Grenzen fiktionalen Erzählens im Mittelalter sollen hierzu kontrastiv auch Texte angrenzender Gattungen einbezogen werden. Ziel des Projekts ist es, mit dem so entstehenden Panorama an graduell und qualitativ unterschiedlich gearteten Techniken und Möglichkeiten fiktionaler Sinnstiftung neue, belebende Impulse für die noch immer rege Fiktionalitätsdebatte zu liefern.
Betreuung:
Prof. Dr. Joachim Hamm (Würzburg), Prof. Dr. Thomas Baier (Würzburg), Prof. Dr. Brigitte Burrichter (Würzburg)
Sebastian Brants Narrenschiff gilt heute als einer der Scharnier- und Schlüsseltexte des Übergangs vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit. In einer Didaxe ex negativo entfaltet der Text das poetische Panorama einer Vielzahl menschlicher Narrheiten. Im Verlauf seiner 109 Kapitel strebt er so die Entfaltung spezifischer, anspruchsvoll verschränkter sowie höchst variant semantisierter Wissens- und Belehrungspotenziale an. Untersucht wird die Entwicklung dieser Potenziale in der frühen Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte des Werks zwischen 1495 und 1574 und damit über sprachliche, kulturelle wie auch werkintentionale Grenzen hinaus.
Besondere Beachtung findet in diesem Zusammenhang die literarische Kategorie des Raums. Die Arbeit reiht sich hier in jüngere Entwicklungen der mediävistischen Literaturwissenschaft ein, die unter dem Begriff des Spatial Turn zu fassen sind. Problematisiert wird im vorliegenden Kontext v. a. die bisher vorherrschende literaturwissenschaftliche Wahrnehmung des Raums als narrativ strukturiertem Phänomen. Erarbeitet werden deshalb analytische und methodische Konzepte zur Erfassung eines eben anderen Raums in einer didaktisch-wissensvermittelnden Dichtung.
Betreuung:
Prof. Dr. Helmut Flachenecker (Würzburg), Prof. Dr. Roman Czaja (Toruń), Prof. Dr. Brigitte Burrichter (Würzburg)
Der Deutsche Orden, nach Templern und Johannitern der jüngste der drei großen Kreuzritterorden, verlagerte nach dem Ende der Kreuzzüge im 14. Jahrhundert seinen Wirkungsschwerpunkt ins Baltikum. Seine Besitzungen außerhalb Preußens gliederte er in Regionen, sogenannte "Balleien". Die Dissertation befasst sich mit der Geschichte der Ballei Elsass-Burgund, gelegen im heutigen Dreiländereck Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Nach einer Aufarbeitung der Geschichte dieser Ballei – die Archivalien verteilen sich heute auf ein Dutzend Archive – wird das Lavieren des Balleiobersten zwischen den beiden obersten Autoritäten des Ordens untersucht, zwischen Hochmeister und Deutschmeister. Innerhalb der Region wird einerseits die Einbindung und die Rolle der Ballei als geistlicher Territorialherr in den lokalen Machtstrukturen, andererseits auch als Glied des Heiligen Römischen Reiches betrachtet. So wird sich allgemein der Frage genähert, welche Bedeutung Elsass-Burgund als "hochmeisterliche Kammerballei" innerhalb und außerhalb des geistlichen Ritterordens im Spätmittelalter zukommt.
Abgeschlossene Qualifikationsverfahren
Betreuung:
Prof. Dr. Isabella von Treskow (Regensburg), Prof. Dr. Martha Kleinahns (Würzburg)
Im Zentrum dieser Untersuchung steht die literatur- und kulturwissenschaftliche Analyse der Novellensammlung 'Femmes d'Alger dans leur appartement' (1980/2002) der aus Algerien stammenden Autorin Assia Djebar. Die Basis bildet eine narratologische Untersuchung der einzelnen Erzählungen, die deren motivischen, ästhetischen und referentiellen Aspekten in ihrer Verschränkung Rechnung trägt. Aus Sicht der Gender Studies gilt geschlechtsspezifischen Fragen ein besonderes Augenmerk ebenso wie der Texthermeneutik: Analysieren, Verstehen und kontextualisierendes Interpretieren werden als sich gegenseitig bedingende Vorgänge betrachtet. Gesellschaftliche, kulturelle, politische, religiöse und geschichtliche Gesichtspunkte, insbesondere koloniale und postkoloniale sowie geschlechts- bzw. genderbedingte Problemstellungen werden aus diesem Blickwinkel gezielt beleuchtet, um Gehalt, Machart und Sinnangebote der Novellen möglichst adäquat verstehen und auslegen zu können.
Eine der zentralen Fragestellungen ist die nach der narrativen Inszenierung sozialer Hierarchien, insbesondere bezüglich der Geschlechter. Besonderes Interesse gilt darüber hinaus subversiven und visionären Elementen von 'Femmes d'Alger dans leur appartement', etwa der Frage, wie darin durch weibliche Stimmen mit sozialem Druck gebrochen wird und welche Ideen suggeriert werden, die in ihrer Realisierung dazu führen würden, die Situation von Frauen in patriarchalen Gesellschaften zu verbessern. Der spezifische Ansatz von Assia Djebar ist, so die These, eine Änderung der Situation von innen heraus anzuregen, dichotomische Vorstellungen zu vermeiden und – wenigstens dem äußeren Anschein nach – Extremen eine Absage zu erteilen. Erst bei präziser, detaillierter Auslotung wird man der rebellischen und reformerischen Kraft gewahr, die ihre Texte auszeichnet.
Aufbauend auf der narratologischen Analyse folgt im zweiten Teil der Publikation der didaktische Transfer: Die Sammlung 'Femmes d'Alger dans leur appartement' wird für die Nutzung im gymnasialen Französischunterricht in Deutschland ausgewertet, aufbereitet und kritisch reflektiert. Geboten werden konkrete Hinweise und gut umsetzbare, die interkulturelle Begegnung stützende Materialien für den Unterricht.
Publikation:
Katharina Gröber: 'Femmes d'Alger dans leur appartement' von Assia Djebar: Eine literatur- und kulturwissenschaftliche Untersuchung mit Vorschlägen für den Französischunterricht. Regensburg: Universitätsbibliothek 2023.
Betreuung:
Prof. Dr. Brigitte Burrichter (Würzburg), PD Dr. Heike Raphael-Hernandez (Würzburg), Prof. Dr. Anja Bandau (Hannover)
Black Costa Rica: Pluricentrical Belonging in Afra-Costa Rican Poetry engages the lyric of Eulalia Bernard (Limón, Costa Rica *1935), Shirley Campbell (San José, Costa Rica *1965), and Dlia McDonald (Colón, Panamá *1965) by a historically backwards-looking perspective that explores a pluricentrical sense of belonging. This concept refers mainly to plural centers of cultural and historical identifications along a (g)local sociohistorical continuum stretched across the multifold aspects of the nation~diaspora dynamic/s. The literary analysis traces the coming of age of the Afro-Costa Rican community in these women’s poetry as a local manifestation of global phenomena concerning Diaspora, the dialectics of Race and Nation, and processes of Assimilation and of Marginalization.
The dissertation asks, fundamentally, how does their poetry reveal a historical imagination referring both to a national specificity while simultaneously expressing identification with socio-historical processes in the circum-Caribbean region? What are the poetic themes and which the lyrical forms that constitute a myriad of local and global aspects regarding the coming of age of the Afro-Costa Rican community?
Departing from these premises, the dissertation tells a story of the past by addressing the ways in which the glocal is deployed through specific figures of speech. Based on the study of what I have termed a modernized-nature oxymoron in McDonald, a skin-history metonymy in Campbell, and code-switching in Bernard, spatial and racial configurations as well as linguistic identity are here addressed as features of a trifold historical imagination yielding pluricentrical belonging. The oxymoron tells of an outernational past (diasporic) while the metonymy declaims a supranational one (global); multilingualism instead points to an infranational historical imagination (‘non’-Costa Rican). By way of a close reading, the dissertation tells the recent story of the country’s past in the form of a three layered stor(y)ing of spatially-, meta-historically-, and multilingually-defined imaginings of Black Costa Rica.
Publikation:
Ravasio, Paola: Black Costa Rica: Pluricentrical Belonging in Afra-Costa Rican Poetry. Würzburg: Würzburg University Press 2020.
Betreuung:
Prof. Dr. Waltraud Weidenbusch (Würzburg), Prof. Dr. Johannes Kabatek (Zürich), [Prof. Dr. Reinhard Kiesler (Würzburg)]
Aufbauend auf den Ergebnissen einer früheren Studie, in der festgestellt werden konnte, dass im nähesprachlichen Spanisch zwar mehr einfache als komplexe Sätze, im Bereich der komplexen Sätze allerdings mehr hypotaktische als parataktische Satzkonstruktionen zu finden sind, wird in der vorliegenden, empirisch ausgerichteten Untersuchung der Fokus geweitet: Im Zentrum des Interesses steht die Frage nach dem generellen Zusammenhang von konzeptioneller Mündlichkeit/ Schriftlichkeit und dem Grad an syntaktischer Komplexität. Hierzu gibt es in der Forschung ganz unterschiedliche Positionen. Weit verbreitet ist die Annahme, dass Nähesprache eher zu einer "einfacheren" Satzkomplexität neige und distanzsprachliche Stile komplexe syntaktische Strukturen bevorzugten. Dabei rekurriert der Komplexitätsbegriff auf die qualitative Unter-scheidung von einfachem und komplexem Satz. Quantitative Aspekte werden meist nicht berücksichtigt.
An diesem Punkt setzt das Forschungsprojekt an: Neben der qualitativen Bestimmung syntaktischer Komplexität für das moderne europäische Spanisch werden auf einer quantitativen Ebene verschiedene numerische Werte, die syntaktische Komplexität abbilden können, miteinander in Verbindung gesetzt. Die Kombination der Werte der Anzahl der finiten Verben einer Konstruktion, der Satzlänge (in graphischen Wörtern) sowie dem maximalen Grad der Einbettungstiefe erlaubt es, die Komplexität von syntaktischen Konstruktionen als Vektor zu fassen. Die Methode ermöglicht somit eine umfassende multifaktorielle Analyse, deren Ergebnisse in einer dreidimensionalen Darstellung münden und die bestehenden Unterschiede graphisch veranschaulicht.
Das der Arbeit zugrundeliegende Korpus setzt sich aus Texten zusammen, die sich aufgrund ihrer konzeptionellen Reliefs an unterschiedlichen Positionen des Nähe/Distanz-Kontinuums ansiedeln lassen. Am Pol der kommunikativen Nähe wurden 3.000 Sätze des Val.Es.Co-Korpus analysiert, während am Pol der kommunikativen Distanz 3.000 Sätze aus wissenschaftlichen Texten (1.500) und Gesetzestexten (1.500) zur Analyse herangezogen wurden. Für die Mitte des Kontinuums wurden ebenfalls 3.000 Sätze aus Politikerinterviews (1.500) und Parlamentsreden (1.500) in Hinblick auf das Ausmaß ihrer Komplexität geprüft, so dass das Korpus für das Spanische insgesamt 9.000 Sätze umfasst. Um die gewonnenen Erkenntnisse zumindest ansatzweise mit dem Französischen zu vergleichen, wurde analog zum Teilkorpus der wissenschaftlichen Texte des Spanischen ein solches mit 1.500 Sätzen der französischen Wissenschaftssprache erstellt und untersucht.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass bisherige Forschungspositionen differenzierter betrachtet werden müssen: So weist beispielsweise die Nähesprache durchaus bestimmte quantitative Komplexitätsgrade auf, gleichwohl distanzsprachlichere Stile Komplexität stärker ausnützen können. Auf einer qualitativen Ebene zeigt sich, dass stilübergreifend v. a. einfache syntaktische Konstruktionen dominieren, während die Multiple Homogene Parataxe, also die mehrfache Aneinanderreihung von Hauptsätzen, stilvergleichend nur sehr gering genutzt wird. Für den Sprachvergleich mit dem Französischen kann festgestellt werden, dass hierbei größere Übereinstimmung auf qualitativer wie quantitativer Ebene zu beobachten ist, als dies für den Vergleich der einzelnen Stile des Spanischen der Fall ist.
Publikation:
Hesselbach, Robert: Diaphasische Variation und syntaktische Komplexität – eine empirische Studie zu funktionalen Stilen des Spanischen mit einem Ausblick auf das Französische (= Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie 433). Berlin/Boston: De Gruyter 2019.
Betreuung:
Prof. Dr. Brigitte Burrichter (Würzburg), Prof. Dr. Susanne Gehrmann (HU Berlin), PD Dr. Irmgard Scharold (Münster)
In der vorliegenden Arbeit werden Kolonialdiskurse aus Belgien und der Demokratischen Republik Kongo vergleichend analysiert und mit der literarischen Repräsentation von Patrice Lumumba (1925-1961) in Bezug gebracht. Lumumba gilt als Vorkämpfer der kongolesischen Unabhängigkeit von der damaligen Kolonialmacht Belgien, wurde 1960 zum ersten Ministerpräsidenten des unabhängigen Kongo gewählt und 1961 unter Mitwirkung belgischer Geheimpolizisten in Katanga ermordet. Der erste Teil der wissenschaftlichen Studie fokussiert sich auf eine diachrone Untersuchung diskursiver Hervorbringungen in Belgien und im Kongo von 1870 bis heute, die den Kolonialismus und seine Auswirkungen thematisieren. Dabei ist festzustellen, dass der belgische Kolonialdiskurs insbesondere in Bezug auf die Ermordung Patrice Lumumbas durch eine geschichtsverklärende Haltung der politischen Autoritäten gekennzeichnet ist, während sich gesellschaftliche Kräfte, Publizisten, Künstler und Wissenschaftler in Belgien seit den 2000er Jahren für eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Kolonialgeschichte einsetzen. In der DR Kongo ist hingegen nach der Kolonisation und nach der autokratischen Herrschaft von Joseph-Désiré Mobutu von 1965 bis 1997 eine langanhaltende 'Stimmlosigkeit' (Gayatri Spivak) kongolesischer Akteure innerhalb des Kolonialdiskurses zu beobachten, die in Anlehnung an Vertreter der postkolonialen Theorie u.a. als Zeichen einer noch immer dichotomisch eingeteilten, (neo)kolonialen Weltordnung zu werten ist.
Der zweite Teil dieser Arbeit befasst sich mit der literarischen Repräsentation von Patrice Lumumba im belgischen Drama (zwei Dramen, 1999 und 2007) und in der kongolesischen Lyrik (13 Gedichte, 1961-2007) in französischer Sprache vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Kolonialdiskursanalyse und orientiert sich am AT9-Test von Yves Durand und François Guiyoba. Dabei lassen sich innerhalb der 13 kongolesischen Korpustexte deutliche Tendenzen einer Heroisierung Lumumbas erkennen, die durch das Wesen der als Geschichtslyrik klassifizierten Texte zu einer literarischen 'Stimmergreifung' innerhalb des Kolonialdiskurses beitragen. Die zwei untersuchten belgischen Dramen, die als Geschichtsdramen identifiziert werden, sind ebenfalls durch eine Heldendarstellung Lumumbas markiert und wenden sich inhaltlich gegen die z.T. verklärende Ausrichtung des Kolonialdiskurses in Belgien. Das gesamte Textkorpus kann somit unter die Gattung der postkolonialen Literaturen gefasst werden, die sich durch das Konzept des writing back und somit durch eine Perspektivenerweiterung, eine Neuinterpretation historischer Ereignisse und eine beabsichtigte Dekonstruktion dominierender Kolonialdiskurse auszeichnen.
Publikation:
Bobineau, Julien: Koloniale Diskurse im Vergleich. Die Repräsentation von Patrice Lumumba in der kongolesischen Lyrik und im belgischen Drama. Berlin u.a.: LIT Verlag 2019. Reihe: Frankophone Literaturen und Kulturen außerhalb Europas/Littératures et cultures francophones hors d'Europe Bd. 12.
Betreuung:
Prof. Dr. Martha Kleinhans (Würzburg), Prof. Dr. Brigitte Burrichter (Würzburg), Prof. em. Dr. Richard Schwaderer (Kassel)
Die vorliegende Untersuchung möchte zeigen, dass der italienische Prosaautor und Ingenieur Carlo Emilio Gadda sich in seinen frühen Schriften in viel größerem Umfang als bisher angenommen der Thematik der modernen Großstadt widmet. Hier soll eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Texten stattfinden, die einen Beitrag zum Verständnis von Gaddas Werk leisten können. Diese Arbeit kann sich dazu auf die in den letzten Jahren von der italienischen Forschung aufgearbeiteten Varianten und Manuskripttexte stützen. Bisher unbekannte Archivmaterialien wurden für diese Arbeit gesichtet und ausgewertet.
Die Analyse zeichnet zunächst nach, welche Vorläufer und Vorlagen aus der französischen und italienischen Stadtliteratur Gaddas Texten zugrunde liegen. Neben dem Einfluss der Werke von Émile Zola erwiesen sich die Stadtautoren Louis-Sébastien Mercier und Paolo Valera als weitere prägende Vorbilder. Es konnte nachgezeichnet werden, welche gängigen Stadtthemen und Motive aus der Tradition Gadda übernimmt.
Gadda arbeitet systematisch die hierarchisch geordneten Gesellschaftsschichten auf. Hier kann gezeigt werden, wie traditionell Gadda in seiner Darstellung der sozialen Milieus vorgeht. Auch er präsentiert dem Leser die Mailänder Gesellschaft über eine Reihe von klar zuordenbaren Motiven und Eigenschaften. Ihm gelingt damit ein literarischer Querschnitt durch die Sozialstruktur im Mailand zwischen den beiden Weltkriegen.
Über die Tradition hinaus geht Gadda in seinen überaus präzisen Architekturbeschreibungen, die den Charakter seiner Stadttexte prägen. Das besondere architektonische Interesse Gaddas kennt in der italienischen Großstadtliteratur der Moderne keinen Vergleich. Wie sich zeigt, hat Gadda sich am Duktus der architekturkritischen Texte des Kunsthistorikers Roberto Longhi orientiert.
Als besonders aufschlussreich erwies sich die Suche nach Gaddas Bildvorlagen. Für das Verfassen seiner Texte benötigt Gadda in seinem Frühwerk stets faktuale Vorlagen. Neue Quellenfunde belegen, dass Gadda Zeitungswerbung als direkte Zitate in seine Mailand-Darstellungen übernommen, kommentiert und sehr frei ergänzt hat. Er leitet einige seiner literarischen Beschreibungsstrategien aus der Kinotechnik ab. Die Identifizierung bedeutsamer Referenzen auf die Malerei vermag seine schriftstellerische Entwicklung nachzuzeichnen. Ein weiterer neuer Befund stellt seine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Werk der Mailänder Karikaturisten Giuseppe Scalarini und Giuseppe Novello dar. Deren bildkünstlerisches Vorgehen überführt Gadda in seine literarische Darstellung. Seine Quellenverwendung geht weit über das bloße Zitieren hinaus, denn die Referenzen werden stets um fiktive Szenen ergänzt und zu eigenen Sprachkunstwerken umgeformt. Aus der Fülle dieser Bildreferenzen mit konkretem Mailand-Bezug erschafft Gadda seine eindrucksvollen Stadt-Collagen, die seine frühen Texte zu einem wichtigen Beitrag zur modernen Großstadtliteratur machen.
Publikation:
Goldmann, Julius: Gaddas Mailand. Heidelberg: Winter 2018
Betreuung:
Prof. Dr. Brigitte Burrichter (Würzburg)
Der Fokus dieser Studie liegt auf dem punktuellen Ausleuchten themenrelevanter Aspekte des deutsch-französischen Krieges von 1870/71. Somit ist die Einhaltung einer chronologischen Abfolge der Kriegsgenese, wie sie gängigen Publikationen zu eigen ist, nicht gegeben. Es sollen vielmehr der Einfluss und die Bedeutung jener kulturell-mentaler und soziomorpher Prozesse recherchiert werden, die sich auf den Fortgang »dieses von vornherein verlorenen Krieges« (»une guerre perdue d’avance«) beziehen und welche in der traditionellen Kriegsliteratur kaum gewichtet bzw. nur marginal gestreift werden. Die Arbeit wird dokumentiert durch eine Vielzahl von Quellen aus der Feder zeitgenössischer Kriegsteilnehmer, Historiker, Politiker und Literaten, von Theodor Fontane bis Léon Gambetta, von Baron de la Belle-Croix bis Napoleon III., von Hans v. Kretschman bis Alfred Duquet, von Karl Tanera bis General Chancy. Zudem konnten in die Arbeit zusätzlich Analysen und Erkenntnisse gegenwärtiger Historiker und Militärs mit einbezogen werden, welche, unisono und in aller Offenheit, die eigentlichen Gründe der französischen Niederlage von 1870/71 darlegen. Des Weiteren wird sichtbar, weshalb die französische Nation nicht fähig und willens war, vom Elfenbeinturm ihrer Selbstüberschätzung in die Niederungen der Realität hinabzusteigen. Hier seien Autoren wie Audouin-Rouzeau, Henninger, Battesti, Frèrejean, David, Guelton, Serman, Bernède oder Dreyfus genannt. Letztendlich runden Besuche des Verfassers an den Kriegsschauplätzen sowie Gespräche mit Menschen aus der Region das Bild des Kriegsgeschehens ab, wobei deren Rekurs auf tradierte Erinnerungen an diesen nahezu 150 Jahre zurückliegenden Krieg in Erstaunen versetzt. Neben der Gliederung in Kapitel ist diese Arbeit in 4 übergeordnete Themengebiete eingeteilt: Der erste, größte Teil (Kapitel 1–22) behandelt das Kriegsgeschehen im Allgemeinen, während sich der zweite Teil (Kapitel 23–24) explizit der Rolle der zeitgenössischen Medien und der dritte Teil (Kapitel 25–27) der Resonanz des Kriegs in der zeitgenössischen Literatur widmen. Der vierte Teil ist als separater Abbildungsteil konzipiert, der die vorherigen Teile ergänzt.
Publikation:
Leipold, Winfried: Der deutsch-französische Krieg von 1870/71. Die Konfrontation zweier Kulturen im Spiegelbild von Zeitzeugen und Zeitzeugnissen. - Würzburg, Univ., Diss., 2015. - [online]. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:20-opus-125434
Betreuung:
Prof. Dr. Gerhard Penzkofer (Würzburg), Prof. Dr. Ralph Pordzik (Würzburg), Prof. Dr. Karl-Heinz Lembeck (Würzburg)
Der Einfluss Friedrich Nietzsches auf die philosophische, künstlerische wie literarische Entwicklung des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts ist enorm. Nietzsches Konzepte des Übermenschen, der ewigen Wiederkunft des Gleichen, die Dichotomie Apollinisch-Dionysisch, die Proklamation vom Tod Gottes u. a. hinterließen ihre Spuren in der Literatur der 98er, 14er und 27er-Generationen – kurzum: in der spanischen Moderne.
Die Dissertation versucht Nietzsches Einfluss nachzuvollziehen, indem sie (1) die Bedingungen erörtert, unter denen der Philosoph in Spanien rezipiert wurde, (2) die für die Textarbeit relevanten philosophischen und ästhetischen Konstrukte Nietzsches darstellt und (3) in der eigentlichen Textanalyse das literarische Material auf die zuvor skizzierten Theorien Nietzsches hin untersucht. Angesichts der radikalen Offenheit des Œuvres Nietzsches muss auch analysiert werden, welche geistige Grundhaltung der jeweiligen Rezeption zugrunde liegt – eine europäische oder nationalistische, eine freigeistige oder antisemitische? Abgerundet wird die Arbeit durch narrative Analysen und Darstellungen der historischen und künstlerischen Entwicklungen jener Zeit, die Eingang in das literarische Textmaterial gefunden haben.
Publikation:
Hüneburg, Erik: Nietzsche und die Spanische Literatur der Moderne. - Würzburg, Univ., Diss. 2015 - [online]. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:20-opus-115085
Betreuung:
Prof. Dr. Brigitte Burrichter (Würzburg), Prof. Dr. Martha Kleinhans (Würzburg), PD Dr. Michael Becker (Würzburg)
Das Leben der beiden Autoren Jean Bodin und Michel de Montaigne wurde von den blutigen Auseinandersetzungen der französischen Religionskriege geprägt. Aus diesem Grund besitzt die Religon in ihren Werken eine herausgehobene Stellung. In "Les six livres de la République" von Jean Bodin gründet dieser sein Prinzip der Souveränität auf die Religion. Diese gibt also die Grundregeln des menschlichen Zusammenlebens vor. In seinem Religionsgespräch "Colloqium Heptaplomeres" vertieft Bodin diese Gedanken und entwickelt ein Toleranzkonzept, das die Möglichkeit des Zusammenlebens verschiedener Religionen in einem Staat vorsieht. Die Religion ist bei Jean Bodin also vor allem ein Instrument, um die Gesellschaft zu organisieren. Michel de Montaigne betrachtet in seinen "Essais" die Religion weit kritischer. Für ihn ist sie eine Instanz, die die Menschen trennt anstatt sie zu vereinen. Er warnt vor ihren zerstörerischen Folgen. Gleichwohl entwickelt Montaigne ein Toleranzkonzept, das auf seiner Grundüberzeugung der Gewaltfreiheit beruht. Es zeigt sich, dass beide Autoren die Religion und ihre Nützlichkeit für die Gesellschaft unter verschiedenen Blickwinkeln betrachten.
Publikation:
Deppisch, Aaron: Die Religion in den Werken von Jean Bodin und Michel de Montaigne. Ein Vergleich. - Würzburg, Univ., Diss., 2015. - [online]. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:20-opus-120412
Betreuung:
Prof. Dr. Brigitte Burrichter (Würzburg)
Die vorliegende Studie entwirft die Konturen einer neuen Philologie, die es erlaubt, in bislang noch nicht dagewesener Weise der Komplexität und den pluralen, multi-dimensionalen Beziehungsgeflechten von Texten systematisch Rechnung zu tragen, ohne an analytischer Präzision und Differenziertheit zu verlieren – und dies in einer kultur- und geschichtsübergreifenden Perspektive. Auf der Basis einer umfassenden Kritik am klassischen Kategorienbegriff wird im ersten Teil ein grundsätzlich neues – transkategoriales und poly-systematisches – Textualitätskonzept entwickelt und durch einen Katalog konkreter neuer Interpretationsverfahren ergänzt. Damit sind die Fundamente für eine nicht-eurozentristische Literaturwissenschaft der Zukunft gelegt, die weit über bisherige Liminalitäts- und Poly-System-Theorien hinausgeht: Komplexität und Ordnung, Universalismus und Pluralismus werden auf neue Weise verbunden. Der zweite Teil demonstriert die Leistungsfähigkeit des neuen Modells. Er konzentriert sich auf zwei Autoren, die als besonders dunkel und komplex gelten: Gottfried Wilhelm Leibniz und Marcel Proust. Mit den neuen Interpretationsverfahren eröffnen sich völlig neue Einsichten in die behandelten Werke und Autoren: Leibniz gibt sich als ein besonders früher Denker des Liminalen und der Poly-Systematizität zu erkennen, der zudem entscheidend auf Prousts ästhetisches Projekt der Recherche eingewirkt hat. Damit lädt die Studie zu einer Re-Kartierung der Denk- und Literaturgeschichte ein, die gleichsam im Inneren Europas selbst ansetzt. Das nicht-eurozentristische, pluralistische Denken lässt sich nun bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen, was es auch nötig macht, die nachfolgenden Jahrhunderte unter diesem Blickwinkel neu zu erforschen.
Publikation:
Ventarola, Barbara: Transkategoriale Philologie – Liminales und poly-systematisches Denken bei Gottfried Wilhelm Leibniz und Marcel Proust. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2015.